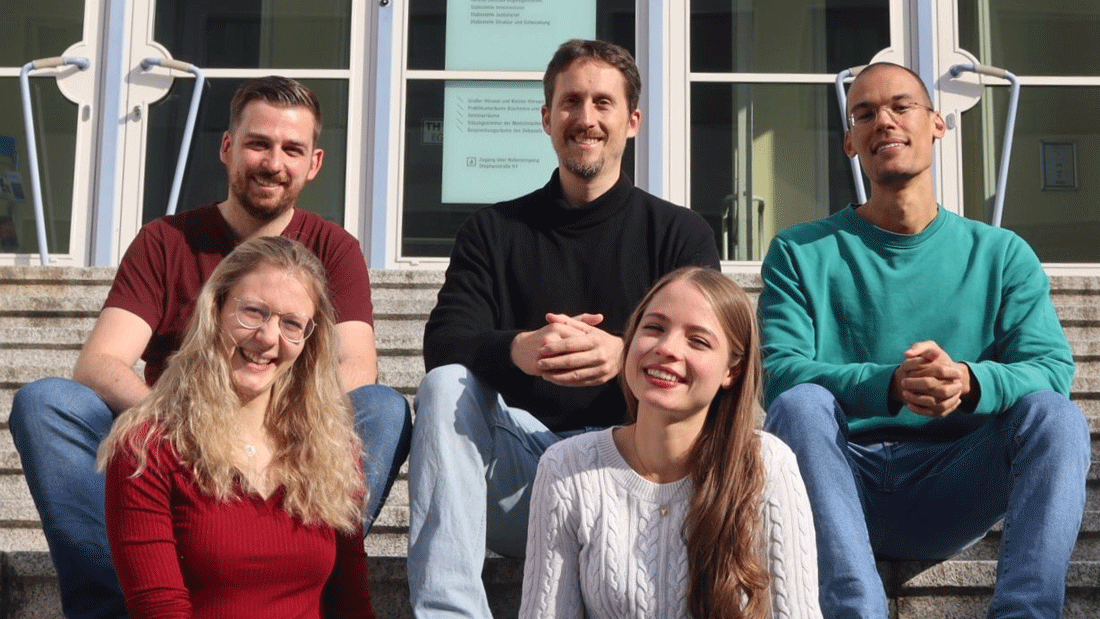Die spinale Muskelatrophie ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung von Nervenzellen des Rückenmarks, die schon im Säuglingsalter auftreten kann. Die Erkrankung führt zu einem fortschreitenden Verlust von Muskelkraft. Betroffene leiden oft schon früh an Muskelschwäche und haben Schwierigkeiten bei Bewegung, Atmung und Schlucken. Durch den medizinischen Fortschritt stehen mittlerweile Therapien zur Verfügung, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Dennoch bleiben motorische Einschränkungen bestehen, und es treten zunehmend kognitive und soziale Auffälligkeiten auf.
Die spinale Muskelatrophie wurde lange Zeit ausschließlich als eine Erkrankung der Motoneurone verstanden, bei der jene Nervenzellen ihre Funktion verlieren, die direkt für die Ansteuerung der Muskulatur verantwortlich sind. In den vergangenen Jahren konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, dass auch andere Nervenzellen im Rückenmark, die die Muskulatur nicht direkt steuern, zur Krankheit beitragen. Basierend auf diesen Ergebnissen haben Forschende des Carl-Ludwig-Instituts für Physiologie nun untersucht, ob weitere Regionen des Nervensystems an der Entstehung der spinalen Muskelatrophie beteiligt sind.
Das Kleinhirn als ein eigenständiger Treiber der Symptome
In der aktuellen Studie fanden sie heraus, dass auch das Kleinhirn zur Krankheitsentstehung beiträgt. „Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass das Kleinhirn nicht nur von der Krankheit betroffen, sondern ein eigenständiger Treiber der Symptome ist. Damit liefern die aktuellen Befunde eine mögliche Erklärung für die anhaltenden motorischen Einschränkungen und die neu auftretenden sozialen sowie kognitiven Probleme von Patientinnen und Patienten trotz moderner Therapien“, sagt Dr. Christian Simon, Leiter der Studie und Wissenschaftler an der Medizinischen Fakultät.
Bei den Untersuchungen konnten die Leipziger Forschenden nachweisen, dass Purkinje-Zellen – zentrale Nervenzellen des Kleinhirns – bei spinaler Muskelatrophie geschädigt werden. Ursache ist die Aktivierung eines bestimmten Signalwegs, der zum Zelltod und zu erheblichen Störungen in den Netzwerken des Kleinhirns führt.
Die Folgen zeigten sich im Mausmodell: Tiere mit spinaler Muskelatrophie wiesen neben motorischen Beeinträchtigungen auch eine deutlich verringerte kommunikative Aktivität auf, die sich in reduzierten Ultraschallvokalisationen äußerte, also hochfrequenten Lauten, mit denen Mäuse normalerweise kommunizieren. Durch die gezielte Wiederherstellung des fehlenden Proteins in den Purkinje-Zellen konnten sowohl die motorischen als auch sozialen Defizite teilweise verbessert werden.
Studierende der Humanmedizin
Für die aktuellen Untersuchungen wurden hochauflösende Bildgebung und Patch-Clamp-Messungen an Kleinhirnschnitten von Mäusen genutzt. Zusätzlich setzten die Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler virale Vektoren ein, um die Genexpression der Mäuse gezielt zu manipulieren.
Eine Besonderheit der wissenschaftlichen Arbeit: Drei der vier Erstautorinnen und -autoren sind Studierende der Humanmedizin und haben im Rahmen ihrer Promotionsarbeit zu dieser Publikation beigetragen. Sie wurden dabei teilweise durch Promotionsstipendien der Medizinischen Fakultät gefördert. Internationale Kooperationen mit der Columbia University, der Johns Hopkins University und der Universität Ulm haben das Projekt maßgeblich unterstützt.
„Unsere Forschung liefert eine wichtige Basis für weitere Studien, die die Veränderungen im Kleinhirn bei spinaler Muskelatrophie in größeren Gruppen von Patientinnen und Patienten untersuchen sollen. Als nächsten Schritt wollen wir vorhandene Therapien an unseren Mausmodellen testen, um zu prüfen, ob sich die Veränderungen im Kleinhirn und die damit verbundenen sozialen Symptome bei der Erkrankung verbessern lassen“, erklärt Dr. Simon.
Quelle: idw
Artikel teilen