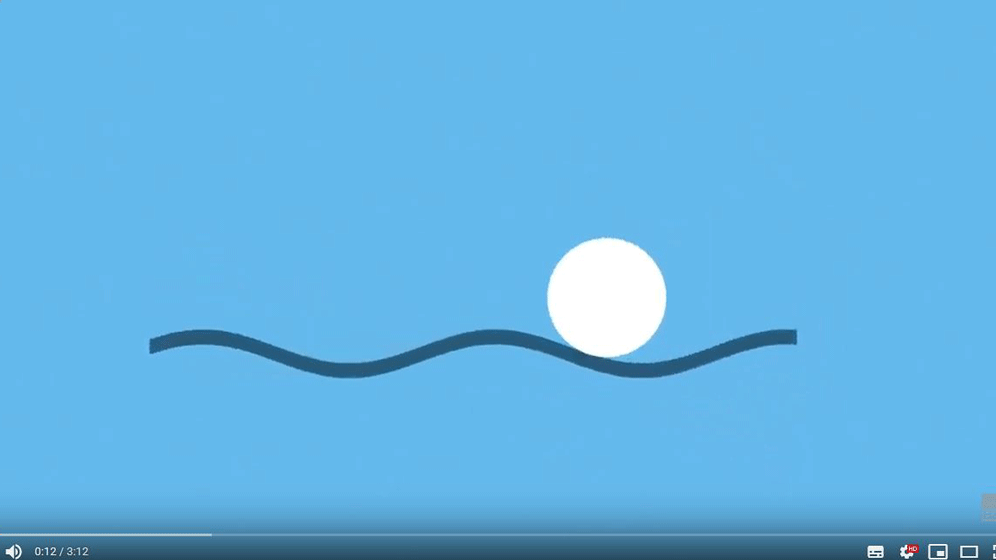Eine neue Studie der Universitätsmedizin Leipzig zeigt, dass nicht nur eher untergewichtige Personen an der Essstörung ARFID leiden können, sondern auch Erwachsene mit einem erhöhten Körpergewicht betroffen sein können. Betroffene lehnen bestimmte Nahrungsmittel ab – entweder aufgrund der Konsistenz, des Geruchs oder auch aus Angst oder Ekel davor. Für sie ist Essen mit Stress verbunden und nicht mit Genuss oder „comfort food“, wobei das auch wieder eine problematische Einstellung zum Essen beinhalten kann.
Fehlgedeutete Symptome
Dr. Ricarda Schmidt und Prof. Dr. Anja Hilbert und ihr Team erforschen das Krankheitsbild bereits seit Jahren und entwickelten für die aktuelle Studie ein diagnostisches Interview, um diese Essstörung gezielt in Personen zu erkennen. „Unsere aktuellen Ergebnisse zeigen, dass ARFID auch bei Erwachsenen mit höherem Körpergewicht vorkommt – wenn auch mit teils anders ausgeprägten Symptomen. Diese Patientinnen und Patienten brauchen eine spezifische Diagnostik und angepasste Behandlungsangebote“, erläutert Schmidt.
Denn im Klinikalltag gehen Symptome meist unter oder werden fehlgedeutet. Für die Studie befragten die Forschenden 369 Erwachsene online, teilweise wurde zusätzlich ein klinisches Interview durchgeführt. So wurden neben selbstberichteten Symptomen auch offizielle Diagnosen erfasst und es konnten mit Bezug auf das Körpergewicht Gesundheitsmerkmale gesetzt werden. Es zeigte sich, dass von den ARFID-Betroffenen 34 Prozent ein erhöhtes Körpergewicht aufweisen. Sie zeigten eher ein wählerisches Essverhalten, eine größere Alltagsbelastung und ein gesteigertes Risiko für Stoffwechselerkrankungen. Der größte Unterschied: während bei den Untergewichtigen 65 Prozent psychosoziale Beeinträchtigungen angaben, waren es 100 Prozent bei denen mit höherem Gewicht.
Zudem zeigt sich, dass ARFID-Betroffene mit höherem Gewicht sich stark mit ihrem Gewicht und ihrer Figur beschäftigen. „Gerade bei Menschen mit höherem Körpergewicht bleibt ARFID oft unerkannt, weil die Gewichtssorgen irrtümlich als Hinweis auf andere Essstörungen oder als Folge von Diätverhalten gewertet werden“, erklärt Schmidt. Daher erhielten Betroffene häufig die falsche Diagnose und werden infolgedessen auch falsch versorgt. Das medizinische Personal müsse sensibilisiert, die Diagnostik überarbeitet und auch die Therapie angepasst werden.
Quelle: idw
Artikel teilen