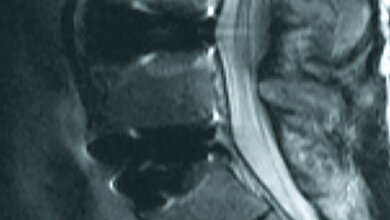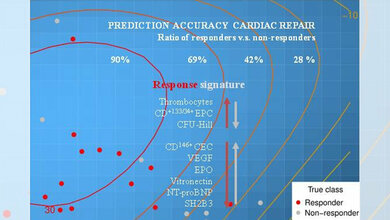Ein internationales Forschungskonsortium mit Beteiligung einer Forschungsgruppe am Inselspital und der Universität Bern konnte sich im europäischen „Horizon 2020“-Programm durchsetzen. Mit dem Projekt „iPSpine“ möchte das Team erforschen, ob körpereigene Stammzellen zur Therapie von abgenutzten Bandscheiden eingesetzt werden können.
Rückenschmerzen, die durch degenerierte Bandscheiben der Wirbelsäule hervorgerufen werden, stellen eine große medizinische und sozioökonomische Herausforderung dar. Die traditionelle Behandlungsmethode bei Versagen von konservativen Therapien ist die Entfernung der degenerierten Bandscheibe (eine sogenannte Discectomy) und eine darauffolgende Versteifung des Gelenkes durch Fusion der benachbarten Wirbelkörper („spinale Fusion“).
Regeneration der Bandscheibe
Die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Benjamin Gantenbein, Gruppenleiter am Institute for Surgical Technology and Biomechanics der Universität Bern, und Prof. Dr. med. Lorin Benneker, Leiter des Teams Wirbelsäule der Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Inselspitals, möchte nun erforschen, inwiefern gewebespezifische körpereigene Stammzellen in der Bandscheibe therapeutisch eingesetzt werden können, um Rückenschmerzen zu lindern, die Bandscheibendegeneration zu stoppen oder abgenutzte Bandscheiben sogar zu regenerieren.
Nun wurde ihnen innerhalb einer kompetitiven „Horizon 2020“-Konsortium-Ausschreibung ein Projekt zugesprochen, um das Potenzial der erst kürzlich entdeckten Bandscheibenstammzellen besser verstehen zu lernen. Das mit mehr als 15 Millionen Euro unterstützte Konsortium wird angeführt von Marianna Tryfonidou von der Universität Utrecht in Holland.
Hauptziel des Projektes ist es, aus notochordalen Zellen (Stammzellen der Bandscheibe) durch Reprogrammierung sogenannte induced Progenitor Cells (iPS) zu generieren, welche für die Regeneration der Bandscheibe sehr gute Eigenschaften aufweisen dürften. Am Projekt beteiligt sind Medizinerinnen, Ingenieure sowie Biologinnen und Biologen von universitären und nicht universitären Forschungsinstitution (das AO Forschungsinstitut in Davos) sowie von Firmen in der Schweiz, Frankreich, Italien, Deutschland, England, Irland, Hongkong, China und den Vereinigten Staaten.
Quelle: Universitätsspital Bern, 15.10.2018
Artikel teilen