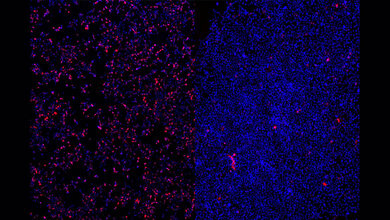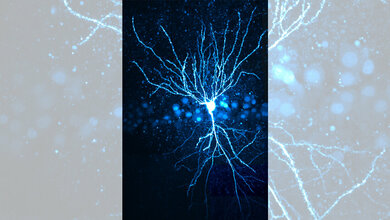Epileptische Anfälle treten aber nicht nur bei Menschen mit Epilepsie auf, sondern auch bei anderen neurologischen Erkrankungen. Sie sind oft nur subklinisch – und entsprechend schwer zu diagnostizieren –, doch sie sind klinisch relevant, weil sie signifikant die Prognose der Betroffenen beeinflussen. Bei Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten beispielsweise kann das Auftreten epileptischer Anfälle die Krankenhaussterblichkeit verdoppeln. Ebenso haben Studien gezeigt, dass das Auftreten epileptischer Anfälle bei MS-Patientinnen und -Patienten mit einer schnelleren Progression, mehr Behinderungen und schlechteren kognitiven Leistungen einhergeht. Auch kommt es bei vielen anderen neurologischen Krankheiten vermehrt zu epileptischen Anfällen, z. B. bei Enzephalitis, Meningitis, bei Intoxikationen, zerebraler Hypoxie oder Hirntumoren.
Risiken minimieren
Es ist wichtig, Anfälle frühzeitig zu erkennen und, wenn möglich, die Anfallshäufigkeit durch eine passende medikamentöse Einstellung auf ein Minimum zu begrenzen. Nicht zuletzt ist es auch die Sorge vor Stigmatisierung, wegen der sich Betroffene eine zuverlässige Anfallskontrolle wünschen. DGN-Kongress-Präsident Prof. Dr. Felix Rosenow geht auf die Risiken bei Epilepsie ein. Es könne bei epileptischen Anfällen zu schweren Stürzen und Unfällen kommen. Letztere könnten auch durch ein eingeschränktes Bewusstsein während der Anfälle verursacht werden, das zu gefährlichen Handlungen führe (z. B. im Anfall auf die Gleise laufen oder die Arbeit an Maschinen fortsetzen). Bekannt sei, dass Patientinnen und Patienten mit einer Epilepsie auch ein 2,5-fach erhöhtes Sterblichkeitsrisiko haben. Häufige Todesursachen seien neben Unfällen und den einer Epilepsie zugrunde liegenden Grunderkrankungen (z. B. Hirntumor) der sogenannte SUDEP (plötzlicher unerwarteter Tod bei Epilepsie), auf dessen Konto etwa 30 % aller Todesfälle von Epilepsie-Patientinnen und -Patienten gehen, die bis zum 60. Lebensjahr versterben [1, 2]. Allein 7–8 % der Betroffenen, die vor dem 20. Lebensjahr an einer Epilepsie erkranken, versterben demnach im Laufe des Lebens an einem SUDEP [3]. Patientinnen und Patienten mit fokalen Epilepsien, die unter Therapie weitere Anfälle, vor allem große Anfälle, haben, haben laut Rosenow das höchste SUDEP-Risiko. Weitere Risikofaktoren seien, allein zu leben und die Medikation nicht regelmäßig einzunehmen. Man könne also sein SUDEP-Risiko durch die Therapietreue minimieren, worüber alle neu diagnostizierten Patientinnen und Patienten aufgeklärt werden sollten [4]. Von besonderer Wichtigkeit sei aber auch, dass die Therapie auf den einzelnen Patienten/die einzelne Patientin zugeschnitten werde. Die moderne Epileptologie biete nämlich zahlreiche Optionen – medikamentös wie nicht medikamentös –, um eine Anfallsfreiheit zu erreichen.
Anfallsdetektion mit neuen Diagnosetools
Betont wird von der DGN, dass bis zu 50 % aller epileptischen Anfälle im Alltag nicht erkannt und/oder korrekt dokumentiert werden. Aufgrund dieser Tatsache sei die präzise Therapie weiterhin erschwert. Mittlerweile gebe es aber mehrere Systeme, beispielsweise spezielle Armbänder, die mithilfe von Sensoren z. B. Herzfrequenz und Bewegungen erfassen, tonisch-klonische Anfälle erkennen und einen Alarm auslösen können. Einige Geräte seien auch speziell für die Schlafüberwachung konzipiert worden. Ebenso gebe es Apps, mithilfe derer die Überwachung via Smartwatch erfolgen könne. Wie eine Erhebung aus dem vergangenen Jahr gezeigt habe [5], seien diese Systeme relativ zuverlässig in der Detektion generalisierter tonisch-klonischer Anfälle: Sie hatten sie mit einer über 90%igen Wahrscheinlichkeit erkannt, allerdings sei es zu 0,1 bis 1,2 Fehlalarmen pro Tag gekommen. Fokale Anfälle, die nur in einer bestimmten Hirnregion stattfinden, könnten diese Systeme hingegen nicht sicher erkennen. Derzeit seien jedoch Anfallsdetektoren in der Entwicklung, die u. a. mit einem subkutanen Elektroenzephalogramm (EEG) arbeiten: Die Hirnströme werden dabei über einen Sensor, der unter die Haut implantiert wird, erfasst.
Behandlung individuell optimieren
„Solche datengestützten Anfallserkennungen geben uns die Möglichkeit, die Behandlung der Epilepsie individuell zu optimieren“, erklärt Prof. Dr. Yvonne Weber, Epilepsiezentrum Aachen, Kongresspräsidentin des DGN-Kongresses 2025. „Die verbesserte Sensortechnologie zusammen mit KI bietet uns hier ganz neue Möglichkeiten. Denn erst mit der richtigen Diagnose lässt sich die richtige Therapie finden.“ Der Goldstandard der Diagnose sei bisher das Langzeit-Video-EEG-Monitoring. Dieses erfolge nun zunehmend auch KI-basiert [6, 7]. Ziel sei die verbesserte Erkennung der klinischen Form und des Verlaufs (beides versteht man unter der sogenannten Semiologie) eines epileptischen Anfalls.
Genetische Untersuchung
Zur Diagnostik gehört laut DGN heutzutage auch die genetische Untersuchung. Zum einen, weil sie eine Prognose für die Zukunft und eine Beratung im Rahmen der Familienplanung ermögliche, aber auch, weil sie bei der Auswahl der richtigen Medikamente hilfreich sei. Beispielsweise seien bei bestimmten Genvarianten der Epilepsie gängige anfallssupprimierende Medikamente wie Natriumkanalblocker unwirksam. Durch die genetische Diagnostik sei, so betont Prof. Weber, perspektivisch auch eine „passgenaue“ Präzisionstherapie möglich [8].
Einsatz von Gentherapien?
Bei zwei Dritteln der Betroffenen lasse sich die Epilepsie durch herkömmliche anfallssupprimierende Medikamente gut behandeln. Allerdings spreche ein Drittel der Patientinnen und Patienten nicht oder nur sehr schlecht darauf an. „Wegen der Gefahr des SUDEP ist aber eine wirksame Therapie aller Betroffenen erforderlich. Bislang stehen nur nicht medikamentöse Therapien zur Verfügung, wenn die herkömmlichen Anfallssuppressiva nicht wirken. Diese sind oft invasiv. Derzeit befinden sich mehrere Gentherapien in der Entwicklung. Sie sind nur für Patientinnen und Patienten aussichtsreich, bei denen die Epilepsie auf eine spezielle Genveränderung zurückzuführen ist. Ganz neu sind chemogenetische Ansätze, die bei allen Patientinnen und Patienten wirken könnten“, erklärt die Aachener Expertin.
Gentherapie bei Dravet-Syndrom
Das Dravet-Syndrom ist eine genetische Epilepsie-Erkrankung, die sich bereits in der Kindheit manifestiert. Sie ist auf Mutationen im SCN1A-Gen auf einem der beiden DNA-Stränge zurückzuführen, infolge derer die Produktion von Natriumkanälen im Gehirn beeinträchtigt ist. Denn dafür ist das Protein Nav1.1 erforderlich, das vom SCN1A-Gen gebildet wird. Bei einer sogenannten Loss-of-function-Genmutation wird dieses nicht in ausreichender Menge produziert.
Es befinden sich verschiedene Präparate in der Entwicklung, die gezielt Nav1.1 adressieren. Ein Beispiel ist eine Gentherapie, die den Adeno-assoziierten Virus 9 (AAV9)-Vektor nutzt, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und so den Wirkstoff (ETX101) direkt in den Zellkern der Neuronen im Gehirn zu bringen [9]. Dieser wirkt am nicht mutierten DNA-Strang – Mutationen befinden sich immer nur auf einem der beiden Stränge – und sorgt dort für eine erhöhte Produktion des NAV1.1 Moleküls, sodass der mutationsbedingte Mangel ausgeglichen wird. Die Therapie repariert nicht das fehlerhafte Gen bzw. den fehlerhaften DNA-Strang, sondern „boostert“ den gesunden – kurz: Sie reguliert die endogene SCN1A-Genexpression hoch. Das Besondere an dieser Therapie: Bereits eine einmalige Gabe des Medikaments soll die Genexpression dauerhaft verändern. Tierexperimentell konnte gezeigt werden, dass das Medikament zu einer verringerten Anfallshäufigkeit und einer verbesserten Langzeitüberlebensrate führte [10]. Aktuell laufen drei Phase-1/2-Studien, um die Sicherheit und Wirksamkeit klinisch zu überprüfen (NCT06283212, NCT06112275, NCT05419492).
Gentherapie bei fokaler kortikaler Dysplasie
Eine Epilepsie mit fokalen Anfällen ist das Kernsymptom einer sogenannten fokalen kortikalen Dysplasie. Auch für dieses Krankheitsbild befindet sich eine Gentherapie in der Entwicklung. Hier wird der Wirkstoff, ein transgenes, künstlich hergestelltes Kaliumkanalprotein (EKC), ebenfalls via AAV9 in das Gehirn gebracht, um die Expression des Kaliumkanal-Gens Kv1.1 zu erhöhen. Eine erste experimentelle Studie [11] zeigte, dass die Injektion von AAV9-CAMK2A-EKC die Anfallshäufigkeit um etwa 64 % reduzieren konnte.
Chemogenetischer Therapieansatz
Eine weiterer neuer Therapieansatz ist laut DGN die Nutzung künstlich entwickelter Rezeptoren, die nur durch spezielle Wirkstoffe aktiviert werden, sogenannter DREADDs („Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs“). In einer Studie [12] wurde ein inhibitorischer Designer-Rezeptor (hM4Di) in die Vorderhirnregion des primären motorischen Kortex (MI) von zwei Affen eingebracht. Anschließend wurde gezielt ein epileptischer Anfall im motorischen Kortex ausgelöst, was zu nachfolgenden schweren epileptischen Anfällen führte. Durch die anschließende Gabe eines passenden, auf den Rezeptor abgestimmten Wirkstoffs (Chloroclozapin) konnten die Anfälle schnell und gezielt unterdrückt werden. „Diese Therapieoption befindet sich noch nicht in der klinischen Prüfung, ist aber ein grundlegend neuer, innovativer Ansatz, mit dessen Hilfe perspektivisch auch grundsätzlich Medikamentenresistenz überwunden werden könnte – und zwar bei allen Indikationen“, erklärt Prof. Weber.
Nicht medikamentöse Anfallskontrolle
Auch bei den nicht medikamentösen Therapieoptionen gebe es wichtige Fortschritte: Etabliert ist die Epilepsie-Chirurgie. Eine Operation wird aber nur empfohlen, wenn die Chancen auf Anfallsfreiheit als gut und die Operation als ausreichend sicher bewertet wird. Bei der OP wird das Gewebeareal, von dem die epileptischen Anfälle ausgehen, entfernt, wenn es keine funktionstragende Rolle spielt. Der große Vorteil dieser Therapie ist ihre hohe Wirksamkeit: Auch nach fünf Jahren sind je nach Lage und Art der Epilepsie im Durchschnitt 60 % der operierten Patientinnen und Patienten noch immer komplett anfallsfrei. Etwa die Hälfte von ihnen kann auch alle anfallssuppressiven Medikamente absetzen. „Dennoch macht die Vorstellung, am Gehirn operiert zu werden, vielen Menschen Angst und sie wünschen sich weniger invasive Verfahren. Das ist durch moderne Stimulationstechniken möglich“, erklärt Prof. Weber.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)
Artikel teilen